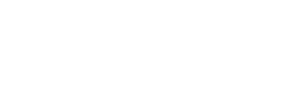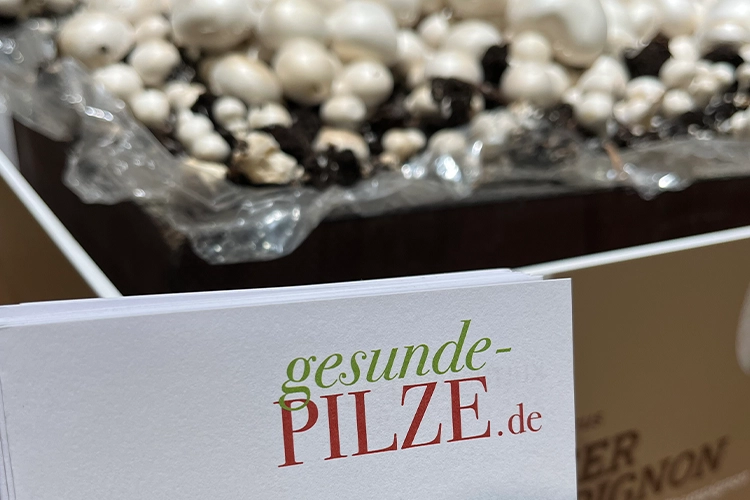Wie kommunizieren Schadpilze an Kulturpflanzen mit ihren Wirtspflanzen? Dieser Frage gehen aktuell ein Forschungsteam an der Universität Darmstadt sowie ein Konsortium mit mehr als 10 Arbeitsgruppen nach. Ziel ist, eines Tages den Einsatz von Fungiziden zu vermeiden. Dafür muss das Team um Projektleiterin Prof. Dr. Vera Göhre zuerst einmal herausfinden, wie die trickreichen Kommunikationskanäle der Pilze funktionieren.
Mais, Kohl, Rüben, Raps oder Reis sind weltweit wichtige Kulturpflanzen – die immer wieder von schädigenden Pilzen befallen werden. Wie schaffen es die Pilze, in die Pflanzen einzudringen und diese umzuprogrammieren? Und wie reagiert die Pflanze darauf? Auf diese zentralen Fragen erhofft sich das Projektteam um Professorin Göhre Antworten. Dies meldet der Informationsdienst Wissenschaft (idw) in seiner Pressemeldung vom 06.02.2025.
Weltweit wichtige Bedeutung
Wie wichtig dies ist, machen Zahlen des Max-Plank-Instituts für Evolutionsbiologie (Plön) deutlich: Mehrere hundert verschiedene Pilzerkrankungen an Kulturpflanzen vernichten jährlich weltweit rund 20-40 Prozent der Ernte. Ohne den Pilzbefall könnten mit diesen Kulturpflanzen etwa 600 Millionen bis 4 Milliarden Menschen ernährt werden. Pilze sind dem Institut zufolge die mit Abstand häufigste Ursache für Krankheiten an Kulturpflanzen und die damit verbundenen Ernteausfälle. Klimawandel und zunehmende Resistenzen verstärken das Problem. Das Projekt an der Uni Darmstadt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DTF) gefördert und soll Licht ins molekularbiologische Dunkel der Interaktion zwischen Pilzen und Pflanzen bringen.
Molekularbiologische Trickkiste
Wichtige Fragen stellen sich gleich zu Beginn: Wie gelangt der Pilz überhaupt in die Pflanze? Bis jetzt weiß man, dass die schlauen Schädlinge in die molekularbiologische Trickkiste greifen können, berichtet der Wissenschaftsdienst. Nach Auskunft Göhres können die Pilze Enzyme absondern, die die Zellwand „wegfressen“. Stößt der Pilz auf die Zellmembran der Pflanze, greift er die Zuckermoleküle ab, die die Pflanzenzelle nach außen abgibt. Diese sind eigentlich für den Weitertransport in die Wurzeln oder die Blüte gedacht. Aber das ist dem Pilz nicht genug: Er schleust eigene Proteine und genetische Informationen durch die Membran in die Pflanzenzellen. Nach Auskunft von Prof. Göhre liegt der neue wissenschaftliche Ansatz in der Untersuchung genau dieses „Hautkontakts“ zwischen Pilz und Pflanze, also dem Kontakt zwischen Pilz- und Zellmembran.
Vesikel für den Transport von Molekülen
Laut aktuellem Forschungsstand können Pilze – wie bestimmte Krankheitserreger in der Medizin – kleine Bläschen, sogenannte Vesikel, für den Transport von Molekülen nutzen. Damit schleusen sie ihre „Werkzeuge“ in die Pflanzen. Und die Pflanzen? Sie antworten ebenfalls mit Vesikeln, um sich zu schützen. Ziel ist nun, die dafür verantwortlichen RNAs zu identifizieren, um sie für den Pflanzenschutz zu nutzen. Man könne dann entweder die Pflanzen genetisch so verändern, dass sie davon mehr produzieren oder indem man RNA-Sprays für den Pflanzenschutz entwickelt – sogenanntes „Spray induced gene silencing“. Dies könne im besten Fall den Einsatz von Fungiziden obsolet machen. Doch dafür sind noch viele Fragen zu klären, so Professorin Göhre.
Quelle: Informationsdienst Wissenschaft (idw) vom 06.02.2025: Trickreiche Pilze: DFG-Projekt an h_da untersucht, wie Schadpilze Kulturpflanzen befallen – Ziel: weniger Fungizid (https://idw-online.de/de/news847063)